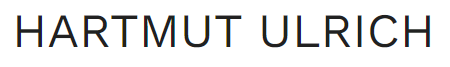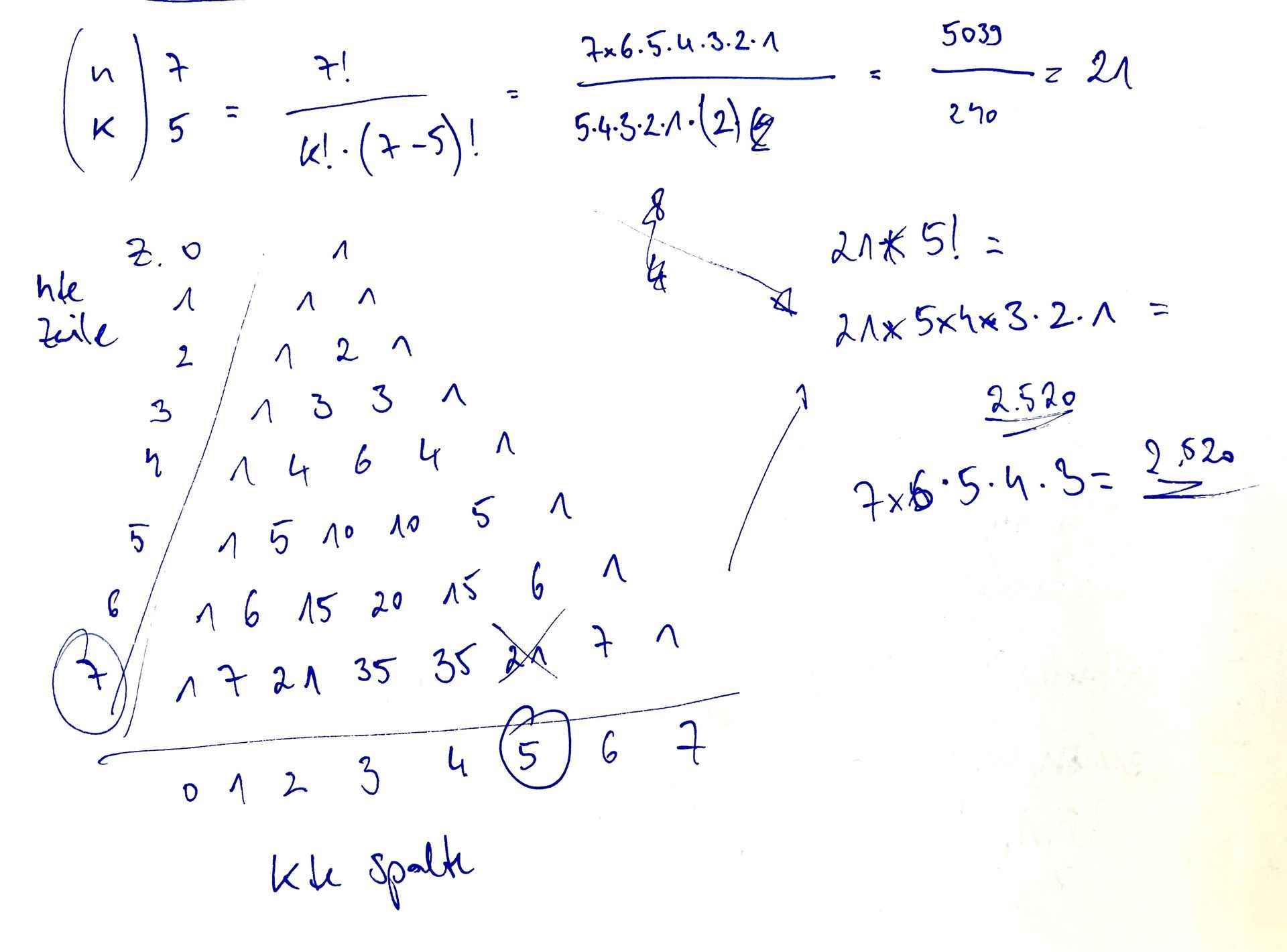Mehr dorniges Gestrüpp!

Hirsche suchen im Spätsommer gezielt nach Brombeerranken, daher heißt die Brombeere auch „Hirschbeere“. Der Name „Bombeere“ stammt aus dem Althochdeutschen "brāma" = „Dornstrauch“, daraus entwickelte sich "Brombeere", „Beere des Dornstrauchs“.
Botanisch sind Brombeeren übrigens gar keine Beeren, sondern eine sog. Sammelsteinfrucht mit ca. 20-50 kleinen Einzelfrüchten. Sie sind reich an Vitamin A, C und E sowie an Ballaststoffen. Ihre Anthocyane verleihen der reifen Frucht die dunkle Farbe. Sie wirken stark antioxidativ, Studien zeigen entzündungs- und krebshemmende Effekte. Die Brombeerblätter enthalten Gerbstoffe, als Tee werden sie gegen Durchfall und Entzündungen eingesetzt.
Als wir vor einigen Jahren das Haus bezogen, in dem wir gerade wohnen, gab es im Garten vor allem Pflanzen, die wir spöttisch „Friedhofsbotanik“ schimpften: Bevorzugt immergrünes Zeug, das auf jedem Friedhof das Vegetationsbild dominiert. Kein einziger Obstbaum oder Beerensträucher - nichts, was bunt blüht, dafür reichlich Dunkelgrün und Bodendecker wie Efeu oder der aggressive Hartriegel (der wild wuchert, wenn man ihn nicht ständig rigoros zurückschneidet, riesig wird und alle anderen Pflanzen um sich herum verdrängt), Scheinzypressen, Thuja (die man nicht richtig zurückschneiden kann, weil sie außen zwar immergrün aber innen braun und tot sind und außerdem giftig), Kirschlorbeer (immergrün und ebenfalls giftig), eine Zierkirsche ohne Kirschen (die Eigentümer scheuten wohl die "Sauerei" mit richtigen Kirschen) sowie eine Trauerweide, bei der du schon beim Hingucken Depressionen bekamst.
Anfang der 70er, als das Haus umgebaut und erweitert wurde, war das offenbar alles sehr angesagt: Nutzwert spielte keine Rolle mehr, man leistete sich den reinen Status und richtete es sich dabei auch im Garten möglichst bequem ein - eine Grundhaltung, die sich bis heute durch Wohlstandsgesellschaften zieht und die ziemlich sicher ihren Teil zur Naturentfremdung beigetragen hat – nur noch übertroffen von den unsäglichen Steingärten, die in einigen Bundesländern mittlerweile sogar verboten sind, weil sie zu noch mehr zur Überhitzung bebauter Flächen beitragen als die verkorkste Stadtplanung ohnehin schon zu verantworten hat, mit ihrer Vorliebe für fantasielose und sterile Flächenversiegelung. Wer z.B. je durch Bielefeld* gegangen ist, vom Bahnhof über den Neumarkt vorbei am Kesselbrink durch die Fußgängerzone und über den Jahnplatz bis vors Rathaus, der kann berichten vom schier grenzenlosen Reichtum der Stadt an trostlos zugepflasterter urbaner Alltagshölle.
Wir haben dann also begonnen, die vorhandene Friedhofsbotanik schrittweise zu ergänzen durch ein kleines Apfelbäumchen, echten Wein, Himbeer- und Stachelbeersträucher, einen Schmetterlingsflieder (der mit seinen lila Blütendolden tatsächlich jede Menge Falter und Hummeln anlockt, sogar mitten in München) und Kapuzinerkresse, die zwar auch lustig alles überwuchert, im Spätsommer aber wundervolle gelbe und orange Blüten treibt. Die sind nicht nur wirklich hübsch, man kann sie auch essen. Sie schmecken leicht scharf und würzig und veredeln jeden Salat. Zwischen dem Rhododendron jedenfalls (Friedhofsbotanik!) drängt sich seit diesem Jahr langsam aber unaufhaltsam eine Brombeere ans Licht. Jetzt im Spätsommer trägt sie erste Früchte. Und damit sind wir beim eigentlichen Teil der Geschichte: Mit Brombeeren verbinde ich ganz wundervolle Kindheitserinnerungen.
Der Soziologe Harald Welzer hat einmal in einem Interview (über Politik) gesagt: „Ich wollte verstehen, wie sich unsere Gefühlsstrukturen überhaupt bilden, weil sie ja für unsere Orientierung oder im negativen Fall Desorientierung verantwortlich sind. Dazu gehören Kindheitserinnerungen, Heimatgefühle, Gerüche, Klänge, Fantasie. All das bildet den Hintergrund unseres Lebensgefühls, wenn man so will, unsere Beziehung zur Welt. Die ist unbewusst, aber gerade deshalb unheimlich wirksam.“ Treffender ließe sich kaum umschreiben, warum Brombeeren mich so berühren. Möglicherweise empfindet der Bielefelder aus genau dem gleichen Grund ähnlich beim Anblick vereinzelter eng in Beton eingesperrter Stadtbäume (Freiflächengestaltungsverordnung! Angemessene Stadtbegrünung! Bebauungsvorschrift!), kann es mir aber nicht so richtig vorstellen. Viel eher empfindet er gar nichts mehr, und Welzer würde diese beinahe schon notwehrähnliche Gleichgültigkeit dem eigenen Wohnort gegenüber wohl eher als "negative Desorientierung" bezeichnen. Natürlich ist das gemein. Der Bielefelder fährt ja zum Beispiel sehr gerne Rad (die Stadt ist reich an Fahrradhistorie und -kultur und müht sich sehr um eine gute Fahrrad-Infrastruktur). Wer Rad fährt, nimmt seine Umwelt definitiv anders wahr, intensiver und bewusster als z.B. aus einem vollklimatisierten Auto. Und mit dem Rad ist man auch in Bielefeld schnell dort, wo es viel schöner ist als zwischen Kesselbrink und Rathaus. Ich für meinen Teil bevorzuge jedenfalls Brombeeren.
Als ich selbst noch ein kleiner Junge war, gingen wir im Spätsommer mit zwei großen Blecheimern in den Wald, um Brombeeren zu sammeln (an anderen Tage Pilze und Heilkräuter). Wir kannten etliche Stellen, an denen die Brombeerhecken meterhoch wucherten und ein nahezu undurchdringliches Dickicht bildeten, in das man aber dennoch hinein konnte, wenn man wusste wie und wo, um drinnen dann wie in einer dornigen Festung umgeben zu sein von unzähligen üppigen Dolden voller tiefschwarzer dicker reifer Brombeeren. Die Blecheimer standen auf einer kleinen freien Fläche mitten im dornigen Gestrüpp und füllten sich langsam aber unaufhaltsam. Wir hatten alte Kleider angezogen und Bauhandschuhe, um beim Arbeiten in dem verwunschenen Gestrüpp geschützt zu sein. Und wenn wir am Abend müde nach Hause kamen, waren die beiden Eimer voll mit Beeren, die Hände und Münder blauviolett, und die Mutter hatte bereits ein frisches Geschirrtuch zwischen den Beinen eines umgedrehten Küchenstuhls festgespannt, durch das die frischen Beeren dann mit einem großen Holzlöffel gedrückt und umgehend zu Saft und Gelee weiterverarbeitet wurden, noch bevor sie den ersten Schimmel ansetzen konnten (was meist nur eine einzige Nacht dauerte, ungewaschen und so ganz ohne Konservierungsmittel).
Das Gefühl völliger Geborgenheit auf der kleinen sonnendurchfluteten Lichtung mitten in den Brombeerhecken trage ich bis heute in mir. Um dich herum war der Wald mit all seinen Gerüchen und kleinen Geräuschen, die Zivilisation und die nächste Ortschaft schienen unendlich weit entfernt, der Spätsommerhimmel mit seinem unverwechselbaren Licht, bei dem sich zur Wärme immer auch schon eine melancholische Note mischte, die den nahenden Herbst bereits erahnen ließ. Dann dieser ganz besondere unvergleichlich wild-würzige Duft der Brombeerhecken, ein paar Vogelstimmen, allerlei Insekten, durch das Zwielicht wabernde Spinnfäden, ein vollkommenes Idyll von heiler Welt, in der Erinnerung natürlich zusätzlich ins wild Romantische verklärt. Der kleine Junge hat sich damals selbst gefühlt wie ein Waldtier, das zuhause war in den Brombeerhecken. Dazu dieses wunderliche, beinahe rauschhafte Glücksgefühl im Kopf (wahrscheinlich war es ja doch nur der Fruchtzucker - möglicherweise aber auch 100.000 Jahre alte Jäger-Sammler-Artefakte in den Genen).
Vielleicht steckt ja viel von der Tragik des modernen Stadtmenschen in der Tatsache, wie wenig er noch für dornige Hecken übrig hat.
Geht mit Euren Kindern in die Brombeeren!
* Es könnte sich auch problemlos um beinahe jede andere deutsche Stadt handeln. Nicht umsonst gibt es beispielsweise das Schimpfwort "Münchner Bauträgerarchitektur", die in ihrer Einfalls- und funktionalen Trostlosigkeit häufiger an Justizvollzug erinnert und sehr viel weniger an eine Antwort darauf, was lebenswertes Wohnen sein könnte. München kann so abstoßend hässlich sein wie jede andere Stadt auch (vor allem in unmittelbarer Nähe zum Mittleren Ring). Nur, dass man dieser Erkenntnis in München auch ganz prima aus dem Weg gehen kann, in Isarnähe oder dem Englischen Garten. Aus Bielefeld kenne ich das Flächenversiegelungs-Trauerspiel jedenfalls aus häufiger eigener Begehung.
👉 kleine Beiträge wie dieser sind Erinnerungen: an reine Freude, die ich empfunden habe - und häufig auch immer wieder, wenn ich sie sehe. Ein ungewöhnlicher Blick, überraschende Sichtweisen und Entdeckungen, inspirierende Kreativität, ein schöner Gedanke, gelungenes Handwerk, schöne Formulierungen, Dinge mit Seele. Sie sind vollkommen zweck- und absichtsfrei - und trotzdem alles andere als sinnlos: Es tut unendlich gut, sich jeden Tag über etwas zu freuen. Und sei es noch so unbedeutend. Enjoy!