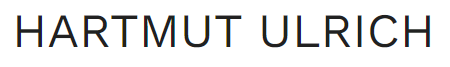Unsupported Ultracycling durch Marokko
Atlas Mountain Race
An Ultracycling-Wettbewerben nimmst du teil, um herauszufinden wer du bist. Hinterher weißt du‘s. Du wirst einiges über dich selbst lernen. Über deinen Stolz, deine mentale Stärke, deine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, deine Schwächen. Auch über deinen Umgang mit Ängsten. Das fängt schon im Vorfeld an, wenn du von Hundeattacken hörst.
Dies ist die Geschichte über das Atlas Mountain Race 2025 in Marokko, eines der faszinierendsten und härtesten Ultracycling-Rennen der Welt. Ein Rennen, das tausend Fehler provoziert - und keinen duldet.

Wüstenabschnitt nach dem Telouet-Pass und Checkpoint eins auf dem Weg nach Afra. Hier gibt es über rund 100 Kilometer nichts - kein Haus, kein Wasser, keine Verpflegung, gar nichts. Nur Sand, Steine und diesen aggressiven roten Staub, der die Lunge und die Schleimhäute reizt und Husten verursacht.
Erfahrung ist das, was du bekommst, wenn du nicht bekommen hast, was du wolltest / ein paar schnelle Fakten
Das Atlas Mountain Race ist ein unsupported Ultracycling-Event unter Extrembedingungen. Mit Start in Marrakesch (2026 wird der Start in Beli Mellal sein, ca. 180 km östlich von Marrakesch) führte es über 1.300 Kilometer und 23.000 Höhenmeter bei Minusgraden in der Nacht über den schneebedeckten Telouet-Pass im Hohen Atlas, durch die Steinwüsten Marokkos, über den Anti-Atlas und vorbei an Agadir bis an die Atlantikküste in Essaouria.
Spektakuläre Wüstenlandschaften, etliche Schiebepassagen ("bike & hike"), fahrtechnisch anspruchsvolle Abschnitte, lange Etappen ohne jede Verpflegungsmöglichkeit und extreme Temperaturunterschiede zwischen den kalten Winternächten und den Sonnentagen der nördlichen Sahara verleihen dem Rennen seinen unvergleichlichen Charakter. Es handelt sich nicht um ein Gravelrennen - auch wenn einige Teilnehmer es auf einem Gravelbike gefinisht haben (sogar auf Fixed Gear Bikes und einem Tandem). Das AMR ist definitiv ein Mountainbike-Rennen. Idealerweise wählt man ein Race-Fully oder ein Race-Hardtail - sollte aber nicht versäumen, für ein Endurance-taugliches Bikefitting zu sorgen. Eine Federgabel mit 100-120 mm Federweg ist mittlerweile der Ideal-Standard unter den Teilnehmer-Rädern. bikepacking.com hat die Räder des AMR gelistet - und noch einige spannende Beiträge mehr.
Der Brite Alex McCormack gewann 2025 in einer Zeit von 3d20h, die Deutsche Marei Moldenhauer stellte mit 4d14h einen neuen Rekord auf und finishte auf Platz 7 als erste Frau überhaupt in den Top 10 der Gesamtwertung. Nach rund 8,5 Tagen endet die Zeitnahme. Nur etwa die Hälfte der rund 300 Solostarter und 30 Pairs erreichen das Finish innerhalb der offiziellen Zeitnahme.
Gegründet wurde das AMR 2021 vom Briten Nelson Trees, der die Idee auf einer halbjährigen Bikepacking-Tour von China nach Europa entwickelte. Es gehört zu einer Serie von mittlerweile drei Mountain Races, ein viertes, das Taurus Mountain Race, ist für Mitte Oktober 2026 in der Türkei geplant.
Eine gute Übersicht der wichtigsten Daten und Fakten rund um das Atlas Mountain Race 2025
bietet die Aufzeichnung bei Dotwatcher
Wer teilnehmen möchte, bewirbt sich auf der Website um einen Startplatz und muss eine Reihe von Fragen beantworten, die die Ernsthaftigkeit und die Gefahren des AMR verdeutlichen. Eine Anmeldung ohne Bewerbung ist nicht möglich. Zudem ist ein ärztlicher Nachweis der körperlichen Tauglichkeit erforderlich. Der Start ist Solo oder als Zweierteam möglich. Die Startgebühren lagen 2025 bei 375 britischen Pfund.
Die ausführliche Story: Erfahrungsbericht vom Start bis zum Abbruch an Checkpoint 2. Aber Vorsicht: ein echter Ultracycling-Longread!
Seit zwei Stunden gehe ich zu Fuß. Stolpere mit dem Bike bergab durch sulzigen nassen Schnee. Meine Stirnlampe irrlichtert unruhig über eine geschlossene Schneedecke und stark verblocktes Gelände. Hier kannst du nicht fahren mit einem bepackten Bike. Also ich kann es nicht. Auf gar keinen Fall willst du hier stürzen. Ganz gleich ob du dir eine Rippe anknackst, den Schädel oder den Rahmen deines Bikes: kommt nicht in Frage. Ein Dutzend Lichter vor mir in der Dunkelheit, eine Handvoll hinter mir. Sie schieben alle. Keiner überholt. Es ist kurz nach Mitternacht, die Spitze des Rennens hat Checkpoint eins vermutlich bereits passiert. Keine Zeit, um auf DotWatcher.cc zu starren. Ich schiebe, die Spitze musste das offenbar so gut wie gar nicht. Wir haben noch etwa 20 Kilometer bis CP1, bei der aktuellen Geschwindigkeit bedeutet das: noch mindestens drei Stunden. Eher mehr. Obwohl ich profilierte Trekkingschuhe anhabe, mit denen es sich hervorragend laufen lässt, rutsche ich im nassen Sulz weg, kippe mitsamt dem Bike zur Seite in den Schnee. Zum Glück kein Felsbrocken. Nichts passiert, aber es bleibt nicht bei dem einen Mal.
Einige Teilnehmer werden sich hier in dem eng verblockten Gelände die Gabeltaschen abreißen. Ich mag Gabeltaschen nicht, sie sind mir zu breit und stören die Fahrdynamik. Mich stört dafür jetzt mein Aero-Aufsatz. Ich ärgere mich, dass ich ihn in letzter Minute doch noch montiert habe. Außerdem hätte ich viel lieber Flat Pedals statt der Klickpedale, Vollfederung und eine absenkbare Sattelstütze. Mein Hardtail ist zwar wirklich leicht, aber das Handling mit einem Fully ist nochmal eine ganz andere Nummer. Patrick Staubach, der beim Silk Road Mountain Race Achter wurde und das hier als Neunter finishen wird, fährt ein Fully. Marei Moldenhauer, die junge Ärztin, die als erste Frau überhaupt in die Top Ten der Gesamtwertung fahren und Siebte werden wird, auch.
Patrick wird später erzählen, er sei diesen Abschnitt zu 90 Prozent gefahren. Fullys sind zwar immer ein paar Kilo schwerer, aber bei solchen Bedingungen ist das eine nüchterne Rechenübung: Wenn du eine solche Passage wie das hier im Schnee fahren kannst, holst du dir einen Zeitgewinn von mehreren Stunden. Durch ein etwas leichteres Bike ist das nicht reinzuholen. Nicht mal über 1.300 Kilometer. Und es kommen ja noch mehr solcher Abschnitte, wenn auch nicht mehr im Schnee - aber in losem Geröll, in Treibsand voller Dornen, in Flussbetten. Ein anderer Teilnehmer erzählt später in Essaouira, er habe wen „retten“ müssen, der mitsamt dem Bike ein Stück am Hang abgerutscht war und nicht mehr aus eigener Kraft mit dem bepackten Bike nach oben kam. Streng genommen war diese Hilfestellung gegen die Spielregeln des Rennens, sie verstößt gegen die Definition von „Unsupported“. War diese Hilfestellung trotzdem in Ordnung, weil sie vielleicht Schlimmeres verhindert hat, im nassen Schnee und in der Nachtkälte? Selbstverständlich - auch wenn sie bedeutet hätte, dass die betreffende Startnummer den Vorgang bei der Rennleitung hätte melden müssen und nicht mehr im Ranking hätte gelistet sein dürfen (über die Auslegung von „Unsupported“ habe ich mir hier ein paar Gedanken gemacht).
Abstieg zu Fuß im Schnee
Fluchend wuchte ich mein Bike wieder hoch. Obwohl meine Schuhe eine Membran haben, bekomme ich nasse Füße: Schnee ist von oben eingedrungen und durchnässt meine Socken. Wir haben gerade erst den Tizi'n'Tichka-Pass überschritten, auch Telouet genannt, mit 2.260 Metern der höchstgelegene Punkt des Rennens. Der Start in Marrakesch liegt erst wenige Stunden zurück.
Punkt 18 Uhr rollen wir mit neutralisiertem Start im Abendlicht die ersten 60 Kilometer flach aus der Stadt, begleitet von Polizeifahrzeugen und erstaunlichen Mengen begeisterter Zuschauer an den Straßenrändern. Mit einbrechender Dunkelheit erreichen wir den Fuß des hohen Atlas. Der Anstieg beginnt, schnell wird es kalt, richtig winterkalt. Es ist ja auch erst Anfang Februar, und das hier ist alpines Gelände. Meine kabellose Eagle XX1 schnurrt, die Übersetzung passt perfekt. Die gewundene Passstraße ist fast bis ganz nach oben asphaltiert, ich fahre konstant und nicht aggressiv. Kein einziges Mal muss ich aus dem Sattel gehen oder absteigen. Ich fühle mich gut.
Kurz vor der Passhöhe kauert eine Gestalt in der Kälte am Straßenrand, ein Teilnehmer, eingehüllt in Biwak- und Schlafsack, bei knapp über Null Grad. Sein Gesicht spricht Bände. Er hat aufgegeben, jetzt schon, nach nicht mal sechs Stunden in einem Rennen, das für die meisten der etwas über 300 Teilnehmer im Feld sechs, sieben Tage dauern wird oder noch länger. Vielleicht ist er krank. Oder verletzt. Bitter. Man lässt sich nicht auf einen solchen Wettbewerb ein, ohne zu wissen, was es bedeutet. Allein der Aufwand, um überhaupt bis an die Startlinie zu kommen! Aber besser hier an der einsamen aber immerhin asphaltierten Straße als irgendwo im Nichts. Wenig später sehe ich hinter mir das Blaulicht des Medical-Fahrzeugs. Sie sammeln ihn auf. Der hohe Atlas fordert sein erstes Opfer. Auf DotWatcher.cc wird man verfolgen können, wie ab jetzt die Zahl jener Namensbalken konstant anwächst, die sich erst nicht mehr bewegen - und dann durchgestrichen sind.
Ich bin bester Dinge. Die Beine sind gut, noch bin ich ausgeruht und frisch. Dass ich rund eineinhalb Liter zu viel Wasser den Pass hinaufschleppe, nehme ich bewusst in Kauf: Mir ist klar, dass es hier für mich nichts zu gewinnen gibt. Mein Ziel lautet auf Ankommen fahren im Zeitlimit, mit nichts als meinem eigenen Rhythmus und meiner eigenen Pace. Also gönne ich mir mehr Sicherheit als vielleicht unbedingt nötig. Über uns strahlt ein makelloser Vollmond und reflektiert so viel Licht, dass sich die schneebedeckten Silhouetten des hohen Atlas deutlich gegen den Nachthimmel abzeichnen. Wunderschön. Der lange und harte Anstieg ist fast geschafft, doch der Abstieg zu Fuß durch den nassen Schnee zieht sich endlos. Weiter, einfach immer weiter.
Gegen sieben Uhr in der Früh erreiche ich endlich Checkpoint eins. Es ist noch dunkel. 13 Stunden habe ich für die ersten knapp 130 Kilometer gebraucht, die komplette Nacht hindurch. Anfang Februar ist es hier noch mehr als 13 Stunden dunkel, Tageslicht gibt es demnach nur etwas über zehn Stunden. Gemessen am Gelände, ist das sogar noch ein recht ordentlicher Schnitt. Zugleich ist es ungeheuer frustrierend, nach 13 eisenharten Stunden gerade mal lächerliche zehn Prozent der Renndistanz auf der Uhr zu haben. Das Wissen, dass dieser Schnitt nicht reichen wird, um das Finish innerhalb des Zeitlimits zu schaffen. Ich muss schneller werden! Schon klar, das hier ist auch einer der schwersten Abschnitte.
Beim Gravelrennen TRAKA 360 in Girona Anfang Mai im Jahr zuvor war ich trotz der Schlammschlacht nach den unerwarteten starken Regenfällen nach 18 Stunden im Ziel – mit einem doppelt so hohen Schnitt trotz der vier Verpflegungspausen, darunter eine längere inkl. Pflege der quietschenden trockenen Kette und Trackertausch wegen leerer Batterie. Das hier ist aber kein Gravelrennen mit Verpflegungsstationen. Es ist ein unsupported Mountainbike-Ultra in einem dünn besiedelten und wenig entwickelten Land, und das erste Drittel ist mit Abstand das schwerste.
Ich bestelle ein Tajine, das traditionelle marokkanische Gargericht, das kochend heiß in einem Tontopf mit pyramidenartigem Deckel serviert wird (der auch Tajine heißt) und verzichte auf die Fleischeinlage mit dem Hinweis, ich sei Vegetarier. Das stimmt zwar nicht, hier in Marokko aber schon. Magen-Darmerkrankungen stehen beim Atlas Mountain Race mit Abstand auf Platz eins der Gründe für unfreiwilligen Rennabbruch. Weder solltest du auch nur einen einzigen Schluck Wasser riskieren (auch nicht unter der Dusche), der nicht aus einer industriell abgefüllten und beim Kauf noch versiegelten Wasserflasche stammt. Noch solltest du der Hygiene in den Garküchen oder Restaurants vertrauen. In Marokko gibt es keine Kühlkette, die Götter wissen, wie lange dein Fisch, Huhn oder Rind schon in der Sonne hing, bevor es bei dir auf dem Teller landete. Haben sie deinen Salat mit dem bräunlich-gelben Leitungswasser gewaschen oder einfach gar nicht? Wurde dein Salat auch mit Abwasser gegossen (in Wüstengebieten üblich), weil Gülle prima düngt? Guten Appetit!
Im Vorfeld des Rennens war auch nicht genug Zeit für mich, mir ein paar Tage Durchfall zu „gönnen“, um meinen verwöhnten europäischen Verdauungstrakt an das lokale Mikrobiom zu gewöhnen. So oder so ist höchste Vorsicht geboten mit Obst und rohem Gemüse – und das bereits im Hotel in Marrakesch. Das reduziert die Möglichkeiten für Ernährung zwar erheblich, sollte mir aber für die Dauer des Aufenthalts keine Sorgen bereiten – anders als bei so manchem anderen Teilnehmer.
Jeder darf Fehler machen: einen
Ron Dennis, der ehemalige Chef des F1-Rennstalls McLaren hat einmal gesagt, in seinem Team dürfe jeder Fehler machen: einen. Provozierende Aussage? Passieren Fehler nicht ständig, sind sie nicht das Menschlichste der Welt, sind Fehler etwa nicht da, um aus ihnen zu lernen? Das Zitat bringt mit maximaler Trockenheit auf den Punkt, was Spitzen- oder Extremsport vom gewöhnlichen Leben unterscheidet: Im Extremsport musst du alle Fehler bereits gemacht und aus ihnen gelernt haben. Sonst bist du raus. Oder tot.
Das Atlas Mountain Race spricht das nicht aus. Es gilt aber trotzdem. „Unsupported“: Über 1.300 Kilometer keine Hilfe von außen erlaubt, du bist komplett alleine für dich verantwortlich, triffst alle Entscheidungen selbst. Auch die falschen. Wer das 39-seitige Race Manual liest in der Bewerbungsphase für einen Startplatz im Juli des Vorjahres, bekommt zwar eine Ahnung davon, dass das kein Sonntagsausflug wird. Aber ohne entsprechende Ultra-Erfahrung kannst du nicht annähernd ermessen, was dich wirklich erwartet.
Ich hätte jedenfalls nicht schlafen sollen an Checkpoint eins, sondern erst mal weiterfahren. Mein Plan war aber, zurückhaltend ranzugehen, nicht gleich zu überpacen am Anfang eines solchen Rennens und nach der kräftezehrenden Überquerung des Telouet dem Körper etwas Ruhe zu gönnen, erst bei Tageslicht weiterzufahren. Nach der Ankunft im Checkpoint, der Brevetstempel-Zeremonie mit Zeitnahme und dem Essen beginnt es aber bereits zu dämmern. Für 60 Dirham (umgerechnet 5,70 Euro) sichere ich mir trotzdem den letzten freien Liegeplatz am Boden im Ruheraum des Checkpoint-Gebäudes, rolle meinen Schlafsack aus und versuche zwischen zwei anderen Teilnehmern zu schlafen. Die Luftmatratze lasse ich eingepackt am Rad, am Boden liegt eine Wolldecke, das muss erst mal reichen.
Wenn ich wirklich müde bin, kann ich mich einfach auf den blanken Boden legen und schlafen, Hauptsache keine Bodenkälte. Für einen erfrischenden Nap reicht es immer. Nur dieses Mal nicht. Statt richtig einzuschlafen, sinke ich in einen unruhigen Dämmerzustand. Der Magen ist mit dem Essen beschäftigt, der ganze Organismus überdreht vom Stress der vergangenen Tage und vom Belastungsschock im hohen Atlas, von der Höhe in immerhin rund 2.000 Metern. Mein Puls kommt nicht runter. Rascheln, Tuscheln, weiter hinten schnarcht einer. Das hier ist kein guter Ruheplatz, da helfen auch die Ohrenstöpsel nichts (ohne bist du eh aufgeschmissen). Der Aufpasser in traditionellem marokkanischem Gewand, der die Liegegebühr kassiert hat und nun auf seinem Stuhl im Ruheraum unentwegt in sein Handy starrt, macht es auch nicht besser. Außerdem ist es jetzt hell. Es ist mir zu warm und zu stickig, ich habe ich mich in voller Montur abgelegt, lediglich die Schuhe ausgezogen. Nach eineinhalb Stunden stehe ich wieder auf und fühle mich wie ausgekotzt. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich Wasser, Cola und Brot gekauft, meine Siebensachen verzurrt, mich mit Sonnencreme eingeschmiert, für die passenden Kleidungsschichten entschieden (es ist sonnig aber immer noch empfindlich kalt) und es endlich aufs Bike geschafft habe. Es ist jetzt fast zehn. Mist, schon so spät!
„This year will be a very cold race”
Es folgt eine längere Passage bis Imassine und von dort nach Afra bei Kilometer 381. Zwischen Imassine und Afra liegt ein rund 100 Kilometer langer Abschnitt roter Steinwüste, in dem es überhaupt nichts gibt. Keine Ortschaft, keinen Shop, kein Wasser, kein Essen, keine Straße, nichts. Nur Geröll und Steine und diesen roten mineralischen Wüstensand, der überall in der Luft hängt, der dir die Schleimhäute reizt und einen seltsamen harten Husten verursacht, der sich anfühlt wie eine Lungenentzündung. Ich kenne die Gefahr aus Berichten früherer Jahre (einige Teilnehmer haben begonnen, Blut zu husten und mussten aufgeben) und bin bereits in Marrakesch mit einem Buff über Mund und Nase gestartet. Hier wird klar, wieso die Berber und Beduinen im Lauf der Jahrhunderte so viele Varianten entwickelt haben, Mund und Nase mit kunstvoll gewundenen Tüchern vor diesem Staub zu schützen.
In Toundoute (km 216) treffe ich am späten Nachmittag ein, weiche von der Route ab und suche nach dem Shop im Ort. Er ist nicht schwer zu finden, ich treffe dort mindestens 30 weitere Rennteilnehmer. Überall lehnen die bepackten Bikes, man streckt die Beine aus, verpflegt sich, trinkt Tee, nickt sich kurz zu, wechselt ein paar Worte. Ich leiste mir gleich zwei Omeletts auf einmal, frisches Wasser und Brot. Außerdem packe ich vier Dosen Makrelen in Öl in die Rahmentasche, wo auch die beiden neuen Wasserflaschen stecken.
Auf Trinkblase und Trinkflaschen habe ich komplett verzichtet. Statt dessen stecke ich die gekauften Plastikflaschen einfach wie sie sind in die Full Frame Bag und in meinen Trinkrucksack. Das spart Zeit und ist viel sicherer. Bei „Badlands“ ist mir die sündhaft teure Apidura-Trinkblase aufgegangen, bei fast vierzig Grad im Schatten habe ich mehr als zwei Liter Wasser verloren und es erst bemerkt, als ich bereits dehydriert war. Ich musste von der Route abweichen und mit meinem rudimentären Spanisch vorbei an den Wachhunden bei bei einer einsamen Hazienda um Wasser betteln. Die Besitzerin wollte keinen Cent annehmen für ihre Rettungstat, ich bin ihr bis heute dankbar, doch seitdem sind Trinkblasen für mich ein No Go bei Ultras.
Nach ein paar Tagen nur mit trockenem Fladenbrot, Omeletts und Cola übersäuert dein Magen, und der Körper schreit nach Fetten (Eiweiß kriegst du mehr als genug über die ungezählten Omeletts; eine Teilnehmerin hat es mal gezählt und kam mit ihrem Pair-Partner auf 70). Außerdem ist das Öl auch ein exzellenter Energielieferant, mit Brot aufgetunkt, schmeckt es köstlich. Die Metallkonserven sind zwar schwer wie Backsteine, ich bin aber trotzdem froh, sie im Gepäck zu haben.
Wir sind umringt von Kindern, und als ich Omelett Nummer zwei nicht ganz schaffe, reißen sie mir nach ein paar aufmunternden Blicken die Reste gierig mit den bloßen Händen vom Teller. Ich realisiere, wie unendlich reich wir auf diese Kinder wirken müssen, kommen den weiten Weg ins Land, nur um sich hier zum Spaß den Arsch aufzureißen, auf futuristischen Maschinen, die sie so noch nie zuvor gesehen haben mit all diesen Bikepacking-Anbauten - und dann vertilgen sie hemmungslos die besten Leckereien, die der Ort zu bieten hat. Die Kinder bekommen Omelett offensichtlich eher selten. Für sie ist es unvorstellbar, wie sich jemand vier Schokoriegel auf einmal leisten kann, mich kosten sie umgerechnet 70 Cent. Die Rennteilnahme selbst schlägt hingegen deutlich vierstellig zu Buche, mit Ausrüstung, Startgebühren, Hotel- und Transportkosten.
Schwer beladen mit 4,5 Litern Wasser und ausreichend Verpflegung steige ich bald wieder aufs Rad und rolle zurück zum Punkt, an dem ich von der Route abgewichen bin, hinein in die einsetzende Dämmerung. Bis Imassine sind es noch knapp 40 Kilometer, dort gibt es nochmal zwei Shops vor dem längeren Abschnitt bis Afra, theoretisch zumindest. Praktisch werde ich dort aber mitten in der Nacht vorbeikommen, nichts wird offen haben. Ich möchte nicht warten müssen, und deshalb habe ich in Toundoute so viel Verpflegung geladen wie ich brauche, um komplett bis Afra durchzukommen. Ich plane, so weit wie möglich zu fahren und dann nach Bedarf ein Stündchen oder auch zwei zu schlafen, wo auch immer ich dann gerade bin. Trotz der verpatzten Erholung an Checkpoint 1 habe ich mich den Tag über recht gut gefühlt und bin auch ganz ordentlich vorangekommen. Nun wird es wieder dunkel und kalt. Die Kälte zieht eine Menge Energie, trotz konstanter Bewegung. Ich ziehe meine langärmlige Jacke an und die Beinlinge. Durch die Temperaturunterschiede zwischen Sonne und Schatten, Anstiegen und Abfahrten, Tag und Nacht, wechselst du ständig die Kleidungsschichten, auch das kostet in Summe viel Zeit.
Der Weg führt nun in völliger Dunkelheit durch eine ausgedehnte Schotterebene mit zahlreichen quer verlaufenden trockenen Flussläufen, in die es steil rein- und steil wieder rausgeht. Es gibt keinen richtigen Weg, das hier ist Offroad. Immer wieder muss ich absteigen und das Rad im groben losen Schotter schieben, stürze einige Male zur Seite, weil ich nicht schnell genug aus den Klickpedalen komme. Sie nerven ohne Ende, abermals wünsche ich mir Flat Pedals. Zudem wird die Wegfindung immer schwieriger. In der Dunkelheit verpasse ich mehrmals eine Abbiegung im Labyrinth von Flussläufen und steil ansteigenden Schotterhügeln. Jeder kleine Verhauer kostet Zeit, Kraft und Nerven. Ich stelle meinen Radcomputer auf die höchste Detailauflösung und mühe mich in der Dunkelheit weiter vorwärts. Zudem vermischen sich Nachtkälte und Erschöpfung im Laufe der nächsten Stunden zu einem Zustand, der mir irgendwann nach Mitternacht sehr deutlich signalisiert, nun dringend eine Pause zu brauchen. Schließlich verlasse ich die Route, fahre etwas seitlich ins Nichts, rolle Luftmatratze und Schlafsack aus.
Es ist spürbar unter Null Grad. Rund um mich ist gar nichts außer Geröll und ein paar karge dornige Büsche. Es ist so kalt, dass ich rasend schnell auskühle, noch während ich die Matratze aufpumpe. Wenigstens ist es nicht windig. Beim Rennbriefing direkt vor dem Start hatte Gründer und Racedirector Nelson Trees gesagt „this year will be a very cold race“. Er hatte Recht. Als er es sagte, konnte ich noch nicht so richtig einordnen, was er mit „very cold“ meinte. Jetzt weiß ich es. Endlich im Schlafsack wird es zwar besser – aber ich wünsche mir mehr Wärme. Der Schlafsack hat eine Komforttemperatur bis fünf Grad, im Moment ist es deutlich darunter. Dafür liege ich mit Wollmütze und Daunenjacke im Schlafsack (mit Abstand die meiste Wärme verlierst du über den Kopf), der Schlafsack steckt außerdem im winddichten Biwaksack, dass muss jetzt einfach genügen.
Als ich aufwache, kann ich kaum die Ausrüstung festzurren, so gefühllos und steif sind meine Finger. Gegen vier in der Früh steige ich bibbernd aufs Rad und fahre los. Der kälteste Punkt einer Nacht ist gegen sechs Uhr am Morgen. Wieder in Bewegung, ist die Kälte auch bald nicht mehr so beißend, ich fühle mich gut und tatsächlich erholt. In Imassine sehe ich zu meiner Überraschung links von der Straße einen Shop, vor dem nicht nur unverkennbar ein paar Teilnehmer-Räder lehnen. Es brennt auch Licht, mitten in der tiefsten Nacht. Die Betreiber haben einfach die ganze Nacht geöffnet und machen vermutlich das Geschäft ihres Lebens. Es gibt heißen Tee, ein Omelett und Heizstrahler mit rot glühender Heizwendel, der den Raum in wohlige Wärme taucht. Außerdem allerlei Süßigkeiten, Kekse und Riegel aus der Vitrine.
Hinten im Halbdunkel liegt eine Gestalt mit dem Schlafsack über dem Kopf, während vorn ein paar Rennteilnehmer an den Plastiktischen essen, sich aufwärmen und bald aufbrechen. Hätte ich mal besser hier biwakiert als da draußen in der Eiseskälte! Aber wer kann schon wissen, dass das Ding hier die ganze Nacht offen hat. Ob ich hier überhaupt hätte schlafen können. In eine Ortschaft zu fahren, um zu schlafen, ist nur dann eine gute Idee, wenn du eine Herberge hast, in einem geschlossenen Raum liegen kannst. Wegen der Hunde. Fast in jeder Ortschaft gibt es Straßenhunde, die nur in der Nähe der Ansiedlungen überleben können. Weiter draußen finden sie nichts zu fressen. Sie riechen dich und dein Essen. Das kann zu Begegnungen führen, die du nicht haben willst. Wenn ich draußen schlafe, dann also lieber in ausreichendem Abstand zu den Ortschaften.
„Es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen“
Die Psychologin und Spitzensportlerin Jana Kesenheimer hat einmal gesagt, beim Ultracycling gehe es gar nicht in erster Linie um den Kopf, wie gerne behauptet werde. Mentale Stärke sei zwar fraglos wichtig (vor allem wie man sich in harten Situationen selber austrickst, um nicht aufzugeben). In erster Linie gehe es aber darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aus meiner Sicht ist beides richtig. Die Bemerkung von Kesenheimer muss man definitiv richtig einordnen, um Missverständnisse zu vermeiden und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Sie spricht vor allem die Unterschiede zwischen einem "normalen" Radrennen und einer Ultra-Herausforderung wie dem Atlas Mountain Race an: Ein Straßenrennen oder ein Triathlon ist auf völlig andere Weise komplex als ein unsupported Ultrarace. Bei klassischen Radrennen ist alles durchorganisiert, abgesperrt. EWs gibt Verpflegungspunkte, Begleitfahrzeuge, Ersatzteile, Mechaniker, Teamfunk usw. Die Fahrer konzentrieren sich auf Taktik, Teamarbeit und Maximalleistung.
Bei einem unsupported Event gibt es all das nicht. Dafür wirken plötzlich ein Dutzend Faktoren auf die eigene Performance: Wetter und Temperaturen, Schlafmangel, Hygiene, Essen, Pausentaktik, Pace, Technik und Pannen, Licht und Stromversorgung, Navigation und Orientierung, Bikefitting, mitgeführte Ausrüstung und Kleidung, Systemgewicht - all das verlangt vor und während des Rennens richtige Entscheidungen. Improvisation ist eher die Regel als die Ausnahme, weil eigentlich immer irgendwas anders kommt als geplant. Ein Ultracycling-Event ist weniger maximale Kontrolle, sondern mehr ein Jonglieren mit dem Chaos. Das braucht viel Erfahrung.
Männer seien statistisch nachweislich schlechter als Frauen bei diesen Entscheidungen, sagt Kesenheimer. Weil ihnen ihr Ego zu sehr im Weg stehe, falsche Bilder von Männlichkeit und Härte. Zu den Gründen, auf der Strecke zu bleiben, gehörten außerdem alle Variationen der sieben Todsünden - allen voran Stolz, Gier und Eitelkeit.
Kesenheimer ist nicht nur Psychologin, sie hat auch das härteste Ultracycling-Rennen Europas gewonnen, das Transcontinental Race, das damals im französischen Roubaix startet und über 4.000 Kilometer und 45.000 Höhenmeter quer durch den Kontinent bis nach Istanbul führte. . In elf Tagen und vier Stunden. (2025 führte es aus dem spanischen Westen in Santiago de Compostela bis an die Schwarzmeerküste Rumäniens) Beim legendären Ötztaler Radmarathon fuhr sie in die Top 10, bevorzugt mittlerweile aber Ultracycling-Wettbewerbe. "Das Besondere daran ist, dass es keine extrinsische Motivation gibt. Es geht nicht darum, auf einem Siegerpodest zu stehen. Denn es gibt keins. Es geht auch nicht um ein Preisgeld. Denn es gibt keins. Sich mit anderen zu vergleichen, ist ebenfalls destruktiv. Du musst versuchen, ganz bei dir selber zu bleiben. Du tust das nur für dich.“
Mit meinen mittlerweile 60 Jahren bilde ich mir ein, über die gröbsten Eitelkeiten hinweg zu sein, eine solide Demut vor den sehr unterschiedlichen Herausforderungen des Ultracyclings zu haben sowie gehörigen Respekt vor dem brachialen Leistungsvermögen der Jüngeren. Trotzdem hat mich eine andere Hybris das Finish gekostet: der Verzicht auf ein professionelles Bikefitting. Mein Hardtail-Mountainbike bin ich nur ein einziges Mal über eine Ultradistanz gefahren, 2022 beim Gravelrennen Badlands in Andalusien. Da war es allerdings umgebaut auf Dropbar, im Grunde also ein ganz anderes Bike. Für das AMR bin ich wieder auf das Original-Setup mit Flatbar gewechselt, ohne damit längere Distanzen getestet zu haben. Ich dachte, es ginge auch ohne, ich könne mich auf mein „Popometer“ verlassen, auf Gefühl und Erfahrung. Fast den gesamten Winter habe ich nur auf dem Rollentrainer verbracht - nicht draußen und nicht auf dem Mountainbike. Die Rolle hat einen Rennlenker und ist bequem eingestellt. Das Mountainbike nicht.
Die Trail Snail
Apropos Psychologie: Ein Stressfaktor, den ich vorher gar nicht auf dem Radar hatte, ist die Trail Snail. Die Satellitentracker übertragen die Positionsdaten der Teilnehmer nahezu in Echtzeit auf eine digitale Karte, schon aus Sicherheitsgründen. Ihre Position ist bei DotWachter.cc öffentlich einsehbar. Das ist für alle spannend, Freunde, Verwandte, Bekannte. Sie können live verfolgen und mitfiebern wie du dich schlägst (was keineswegs nur ein Vorteil ist!). Es ist aber auch für das Teilnehmerfeld spannend: Wo auch immer gerade Mobilfunknetz ist und eine kurze Pause, guckst du nach, wer gerade wo ist auf der Strecke. Sehr hilfreich für die eigene Rennaufteilung! Mit unterwegs auf der digitalen Streckenkarte am Ende des Feldes ist eine kleine rote Schnecke, so eine Art digitaler Besenwagen. Das ist die Trail Snail.
Die Schnecke bewegt sich exakt mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, die rein rechnerisch nötig ist, um das Rennen innerhalb des Zeitlimits zu finishen. Das tut sie unerbittlich, rund um die Uhr ohne Pause, auch während der Nächte. Und sie berücksichtigt keinerlei Geländeunterschiede, es ist einfach ein Durchschnittswert. Wenn du also weißt, dass du weder gewinnen noch überhaupt vorne mitfahren kannst und lediglich innerhalb des Zeitlimits finishen willst, ist die Schnecke das Maß aller Dinge für dich. So lange du vor ihr bist, alles easy. Aber wehe, du hast versehentlich ein paar Stunden zu lange gepennt und liegst plötzlich hinter der Schnecke!
Der Bikefitting-Fehler
Aero-Lenkeraufsätze bescheren dir auf langen Distanzen zusätzliche Griffpositionen und Entlastung, vor allem für die Hände und den Rücken. Du kannst während der Fahrt die Arme ablegen, entspannt vor dich hinrollen. Aerodynamik spielt auf Schotter zwar eher eine untergeordnete Rolle – außer bei langen Abschnitten mit Gegenwind, da sparst du in Liegeposition tatsächlich eine Menge Watt im Vergleich zur normalen Haltung auf einem Mountainbike. Der Nachteil bei Ultra- Distanzen (eine Ironman-Langdistanz ist übrigens keine Ultradistanz, die 180 Kilometer dauern ja „nur“ vier bis sechs Stunden) besteht allerdings darin, dass die Aero-Haltung den Nacken deutlich stärker beansprucht als jede andere Position auf dem Bike. Hast du auf dem Helm außerdem noch eine Lampe installiert, drückt deren Gewicht zusätzlich auf die Nackenmuskulatur, so leicht sie auch sein mag. Ohne gesondertes Training ist der Nacken nicht besonders kräftig, vor allem meiner nicht. Außerdem habe ich einen ziemlich langen Hals, was die Hebelwirkung zusätzlich negativ beeinflusst.
Als Langbeiner mit 187 cm Körpergröße muss ich bei Standard-Rahmengeometrien sowieso immer mit einer gewissen Sattelüberhöhung klar kommen. Für einen Aerolenker brauche ich dann eine ziemlich stark erhöhte Armauflage, damit das überhaupt ergonomisch akzeptabel und halbwegs bequem wird. Am Lenker führt das immer zu einem recht sperrigen Aufbau, kleinere Fahrer haben es da leichter. Noch im Hotel in Marrakesch beim Zusammenbau des Rads hatte ich mit mir gehadert, ob ich die Aerobars überhaupt montieren sollte. Immerhin wiegen auch sie ein paar hundert Gramm extra, und ich war mir alles andere als sicher, ob sie mir tatsächlich den großen Komfortgewinn bescheren könnten.
Auch hier: Vorher ausgiebig testen wäre richtig gewesen! Nicht nur die Ergonomie der Aerobars wurde zum Problem, auch ihre Mechanik: Immer wieder lockerten sich bei den rumpeligen Abfahrten die Schrauben der Fixierschellen, wahrscheinlich weil die Hebelkräfte durch die langen Auflieger schlicht zu groß waren für die Klemmung. Bei einem Straßen-Triathlon ist das kein Kriterium, bei einem bumpy Mountainbike-Rennen schon. Ich wollte die Schrauben aber auch nicht sinnlos zuknallen, um sie nicht abzureißen und keinen Lenkerbruch zu riskieren. Die beiden Auflieger bogen sich dann bei jedem härteren Stoß nach unten weg und blieben ums Verrecken nicht in Position. Schließlich habe ich die Schrauben doch bis zum Anschlag festgezogen. Hat trotzdem nichts genützt, Hebelgesetze sind unerbittlich. Kurz: Ich hätte die Dinger daheim lassen sollen.
Das größte ergonomische Problem bestand aber gar nicht in den Aerobars. Sondern im zu breiten Mountainbike-Lenker. Ein Race-Hardtail wird für schnelles hartes Antreten bergauf konstruiert und für sichere Kontrolle in technisch anspruchsvollem Gelände - wenn auch nicht für größere Drops oder extreme Rahmenbelastungen. Die sportlich-dynamische Lenkerbreite von 78 Zentimetern sieht vielleicht besonders instagrammable und cool aus, führt aber selbst bei einem großen Fahrer wie mir zu einer äußerst unergonomischen Haltung. Auf kürzeren Distanzen ist das ziemlich egal – aber nicht bei einem mehrtägigen Ultracycling-Wettbewerb. Ich hatte mir deswegen vorsorglich Inner Bar Ends auf Schulterbreite am Lenker montiert und gehofft, die würden ausreichen, um die Überspreizung der Arme nicht zum Problem werden zu lassen. Eine zu breite Handposition ist nicht nur schlecht für die Handgelenke und die dort verlaufenden Handnerven (sie werden zu stark abgeknickt und auf Dauer abgeklemmt, was zu Taubheit in den Fingern führt), sie erhöht auch die Belastung für die Nackenmuskulatur. Tatsächlich bin ich wegen der vielen schwierigen technischen Passagen sehr viel häufiger mit den Händen in Außenposition gefahren als ich angenommen hatte.
Ein weiterer Fehler war ziemlich sicher meine Brille: Seit ich 45 bin, brauche ich eine Gleitsicht-Korrektur und habe mir deswegen einen optischen Clip machen lassen. Nicht billig, lohnt sich aber. Mit dem Clip kannst du problemlos und schnell auf verschiedene Gläser wechseln für Tag und Nacht oder gleich die ganze Brille. Geschliffene Gläser sind deutlich schwerer, dann zahlst du für jede Variante, außerdem reduziert sich die Auswahl auf weniger Sportbrillen-Modelle. Der optische Einsatz war bereits etliche Jahre alt, tat es aber immer noch. Schließlich muss ich auf dem Rad kein Kleingedrucktes lesen. Mit der Zeit hat sich meine Fernsicht aber weiter verschlechtert, eigentlich wäre längst ein neuer Clip fällig gewesen. Stattdessen hob ich nun den Kopf ein bisschen mehr an als normalerweise nötig, um den untersten Gleitsichtbereich in den Fokus zu rücken. Das funktionierte, beanspruchte die Nackenmuskulatur aber auch zusätzlich.
Die drei Fehler summierten sich nun also, Kilometer für Kilometer, Erschütterung für Erschütterung. Da nützte auch die wunderbare Rockshox Federgabel nichts, für die ich vor dem Rennen extra noch einen Dämpferservice gemacht hatte, Öl und Dichtungen erneuert und den Luftdruck exakt eingestellt, um nur ja auf Nummer sicher zu gehen.
Bittere Entscheidung
Von Afra (km 381) geht es konstant und recht komplikationslos bis Taznakht (km 510), einem größeren Ort mit guter Infrastruktur und allerhand Shops und Restaurants - ganz offensichtlich vom Tourismus befeuert. Ich verbringe eine weitere kalte Nacht im Freien, rolle meine Isomatte hinter einer Baracke mit Schutthaufen am Weg aus, esse eine Fischkonserve mit Brot, schlafe etwa zwei Stunden und setze meinen Weg fort in Dunkelheit und Nachtkälte, weiter bergauf. Gefühlt immer nur bergauf.
Taznakht erreiche ich am Nachmittag. Ich esse ein Omelett in einem Straßenrestaurant und fülle meine Vorräte auf. Als ich wieder aufs Rad steige, merke ich, dass etwas nicht stimmt. Trotz der warmen Nachmittagssonne ist mir irgendwie kalt. Die schnurgerade, mäßig befahrene Asphaltstraße (einer der seltenen asphaltierten Abschnitte) führt über ein paar Kreisel aus Taznakht heraus bis zum Horizont, wo die nächste Bergkette wartet. Es bläst ein konstanter Gegenwind, aber ich habe nicht die geringste Lust, mich in Aeroposition zu begeben. Fühlt sich nicht gut an. Ich motiviere mich mit dem Gedanken an Checkpoint 2, der noch etwa 80 Kilometer (und etliche Höhenmeter) entfernt liegt, und an dem ich mir wieder ein paar Stunden Schlaf gönnen will, ärgere mich über die penetrant lockeren Aerobars und das sinnlose Gewicht, das ich da mitschleppe und trete weiter möglichst gleichmäßig gegen den Wind an.
Eins der Geheimnisse für sehr lange Rennen besteht darin, sich die Distanz in lauter kleine Schritte zu zerlegen und dann runterzuzählen. Noch zehn Kilometer bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Come on, nur noch vier Kilometer Anstieg, packst du easy. Noch drei, noch zwei, noch einer, Abfahrt, yeah! Zu diesem Zeitpunkt liege ich ordentlich in der Zeit und muss auch keine Angst vor der Trail Snail haben. Doch in den folgenden Stunden verschlechtert sich mein Zustand Kilometer um Kilometer. Immer wieder muss ich den Nacken unterstützen, indem ich mit der Faust von unten gegen das Kinn drücke. Schließlich fahre ich sogar im Stehen, um dem Nacken Entlastung zu verschaffen. Es wird immer schlimmer.
Und dann doch noch die Hunde
Als ich bereits wieder in völliger Dunkelheit eine Ansammlung von Häusern passiere, höre ich aus der Ortschaft heraus wütendes Hundegebell. Trotz der teilweise wilden Berichte über Hundebegegnungen, waren meine Begegnungen mit Hunden bisher weitgehend friedlich. Szenestar Sofiane Sehili musste 2023 das Hellenic Mountain Race abbrechen, weil er von einem Hirtenhund gebissen wurde, Ulrich Batholmös stürzte beim Atlas Mountain Race 2024 kurz vor dem Finish über einen mitlaufenden Hund, der plötzlich einen Haken schlug und brach sich eine Rippe. Keine nächtliche Störung bei mir bislang, die Hunde in den Ortschaften wirkten eher müde und wenig interessiert an Radfahrern. Nur dieses Mal nicht.
Das Bellen kommt rasch näher, zwei Hunde hetzen mich. Ich sehe sie nicht, höre aber sehr deutlich das rhythmische Patapp-Patapp ihrer Pfoten auf dem harten Boden. Ich gebe Vollgas. Zum Glück geht es gerade ein bisschen abwärts, die Federgabel kutschiert mich sicher und schnell über die steinige Schotterpiste. Rechts hinter mir höre ich jetzt auch das Keuchen des schnellsten Verfolgers. Er bellt nicht mehr, braucht seine Luft, um hinterherzukommen. Ich bin um die 50 Stundenkilometer schnell, das wird der Drecksköter nicht lange durchhalten. Ich allerdings auch nicht. Endlich lässt er ab, der zweite ist schon ein bisschen länger abgehängt. Ich nehme Geschwindigkeit raus, beruhige meinen rasenden Puls. Alter, das war knapp!
Einen Hund abzuwehren ist normalerweise gar nicht so heikel. Statt zu flüchten, bremst du besser, steigst ab, bringst das Rad zwischen dich und den Hund, provozierst nicht, signalisierst aber deutlich und selbstbewusst, wer hier der Chef ist. Oft genügt es, ein bisschen mit Wasser aus der Trinkflasche zu spritzen oder einen Stein zu werfen. Bei zwei Hunden oder noch mehr ist das aber anders. Da ergibt Anhalten keinen Sinn, die nehmen dich in die Zange, sie schaukeln sich gegenseitig hoch, für die bist du flüchtende Beute. Und du kannst dich immer nur auf einen konzentrieren.
Eine Scheißerfahrung, braucht kein Mensch. Leider gehört sie auch zu diesen Rennen. In Andalusien während „Badlands“ gab es mehrere solcher Begegnungen. Auf den letzten 50 Kilometern vor dem Ziel hat uns ein wütender großer Hund gestellt, der aus einem Grundstück geschossen kam, allerdings am Tag. Ich bin abgestiegen und habe dem Köter meine ganze Erschöpfung und Wut entgegengebrüllt, so dass er (zu meiner eigenen Überraschung) nach kurzem Zögern sichtbar erschrocken flüchtete. Christian, mit dem ich das Rennen damals gemeinsam bestritt, war von meinem Ausbruch mindestens so überrascht wie der Hund. Er meinte später, da sei für einen kurzen Moment mein finsterster Dämon zum Vorschein gekommen. Dabei mag ich Hunde. Aber nicht, wenn sie mich in der Nacht verfolgen oder überhaupt auf dem Rad und ich mich sowieso schon fühle wie angeschossenes Wild.
Mein Körper ist geflutet mit Adrenalin, für eine kurze Weile sind die Nackenprobleme vergessen. Alles ist wieder still, bis auf das Knirschen meiner Reifen im Schotter. Hinter mir höre ich immer noch Bellen. Es gilt nun aber nicht mehr mir. Die Biester haben umgedreht und gehen nun offenbar auf einen anderen Teilnehmer los, der ein Stück weiter hinter mir unterwegs ist. Später im Checkpoint werde ich mitbekommen, wie er seinem Ärger und seiner Angst Luft macht am Tisch bei der Rennleitung, wo es die Stempel ins Brevet gibt.
Bis zum Checkpoint sind es jetzt noch etwa 20 Kilometer. Ich kann den Kopf nicht mehr halten. Als wäre das Genick gebrochen! Ein Gefühl völliger Hilflosigkeit. Der Weg vor dir steigt an, du hast eigentlich genug Druck auf den Pedalen, kannst aber nicht fahren. Weil du nichts siehst, maximal dein Oberrohr, höher geht es nicht. Das geht so nicht, bei der Piste in der Dunkelheit. Ich steige ab und schiebe. Sobald der Kopf aufrecht ist, geht es. Ich brauche zweieinhalb Stunden, bis ich den Checkpoint erreiche.
Beim Totalversagen der Nackenmuskulatur handelt es sich um eine seltene Überlastungsverletzung, ein medizinisches Phänomen, das so gut wie ausschließlich bei Ultradistanzfahrern auftritt und das erstmalig bei Michael Shermer diagnostiziert wurde, einem der Organisatoren des fast 5.000 Kilometer langen Race Across America (RAAM), das er selber mehrmals gefahren ist. Es heißt „Shermer’s Neck“. Und ich habe es.
„Never scratch in the evening”
Ich bestelle erst einmal ein großes heißes Tajine mit Couscous, hole mir den Zeitstempel für mein Brevet-Heftchen, den zweiten von vier bis ins Finish und reserviere mir einen Platz auf dem Sofa im dunklen Nebenraum, indem ich meinen Schlafsack dort ausrolle. Die Zimmer sind alle belegt. Es ist fast zwei Uhr morgens, wieder einmal ist es erheblich später als geplant. Das war ein Krimi bis hierher. Die Trail Snail rückt unerbittlich weiter, ist aber trotzdem noch weit genug hinter mir. Die macht mir keine Angst. Was mir hingegen Angst macht, ist der Nacken. So etwas habe ich noch nie erlebt. Eine der eisernen Regel für Ultrawettbewerbe lautet: „Never scratch in the evening“ – niemals am Abend aufgeben oder in der Nacht, ganz egal wie scheiße es dir geht. Triff Entscheidungen erst am Morgen, bei Tageslicht! Traue niemals dem, was dir dein Kopf in der Nacht erzählt! Ich wiederhole: niemals! Mit ein paar Stunden Schlaf sieht die Welt am Morgen meistens schon ganz anders aus, und dein Hormonhaushalt hat nicht diesen nächtlichen Horrormix, der die Wirklichkeit einfach anders wirken lässt.
In der Tat ist die Nackenverletzung in aufrechter Haltung gar nicht so dramatisch. Ich mühe mich mit dem Essen ab, habe keinen rechten Hunger. Irgendwann ist der Teller trotzdem leer, ich krieche benommen in meinen Schlafsack und bin beinahe sofort weg. Als ich wieder aufwache, sind vier Stunden vergangen. Ich fühle mich schrecklich. Nicht nur vollkommen aus dem Takt, auch totale Mattscheibe. Offenbar habe ich aus dem winterlichen München eine Infektion mit nach Marokko geschleppt und unter Extrembedingungen ausgebrütet. Die ganze Stadt war krank vor der Abreise Anfang Februar, die Familie inklusive. Alles hat gehustet und geschnieft. Influenza, RSA-Virus, Keuchhusten, Corona, Rhinoviren in allen Variationen, in der S-Bahn, beim Einkaufen, zuhause, überall. Nur ich nicht. Tja.
Es ist jetzt nach sechs Uhr, bald wird es hell. Ich schlürfe Kaffee, hoffe, dass die Lebensgeister zurückkommen, der Kampfgeist. Er kommt nicht. Ich bin krank. Eine halbe Stunde später treffe ich die Entscheidung: Besser hier abbrechen als vielleicht mitten im Nichts nicht mehr weiter zu können. Es geht im nächsten Abschnitt auf die Old Colonial Road, da kommen Autos über weite Stücke nicht hin. Spiel nicht den Helden Digger, das ist es nicht wert! Hier an CP2 werde ich ein Auto organisiert bekommen, das mich und mein Rad bis nach Essaouira bringt. Das sind von hier aus auch auf dem direkten Weg immer noch fast 500 Kilometer. Und ich spreche weder Französisch noch Arabisch. Als ich den Tracker mit Grabesmiene bei der Rennleitung abgebe, zögert sie keine Sekunde, nimmt ihn entgegen, murmelt ein paar bedauernde Worte, schaltet ihn aus und macht den Eintrag in der Teilnehmerliste. Aus die Maus. Gescheitert. Mein Name bei DotWatcher.cc ist nun auch durchgestrichen. Mentaler Tiefpunkt. Obwohl es die richtige Entscheidung ist: Hölle.
Finish in Essaouria
In Essaouria treffe ich gerade rechtzeitig ein, um die Spitze des Rennens zu beglückwünschen: Alex McCormack sitzt mit seiner Freundin am Boden in der Sonne, genießt sein Finish und seinen Sieg. Wir wechseln ein paar Worte. Noch lehnen nur eine Handvoll Räder auf dem schmalen Durchgang zum Restaurant „El Yakout“, dem Finish gleich rechts hinter der alten Stadtmauer von Essaouira. Benedikt Borsos, das Kraftpaket aus Ungarn, hat sich bis ins Finish einen harten Zweikampf mit McCormack geliefert und kam nur eineinhalb Minuten nach ihm ins Ziel. Eine Wahnsinns-Leistung, trotzdem sieht er nicht glücklich aus.
Am Tag darauf sitze ich beim Essen mit Marei Moldenhauer am Tisch. Die 29-jährige Ärztin hat es als Hobbysportlerin in die Top Ten geschafft, auf Platz sieben der Gesamtwertung, als erste Frau überhaupt. Mit am Tisch sitzt auch Lukas Neubeck, als Achter der Gesamtwertung rund zwei Minuten hinter Moldenhauer im Ziel, nahezu zeitgleich mit Patrick Staubach, der ein bisschen enttäuscht ist von seinem neunten Platz, und der erzählt, dass er den Abstieg im Schnee vom Telouet zu 90 Prozent gefahren sei.
Marei krächzt ein paar Bemerkungen zum Rennen, sie ist ohne Mundschutz gefahren, hat viel von dem aggressiven roten Staub geschluckt, hustet, ihre Stimme ist weg. Sie geht schlafen. Unfassbar stark, diese zierliche zurückhaltende Frau! Lukas legt sich in voller Montur auf das Sofa hinter uns und fällt binnen Sekunden in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf, für eine volle Stunde, der Mund steht ihm dabei offen als wäre er gerade gestorben. Noch am gleichen Abend fährt er mit Patrick die 180 Kilometer zurück nach Marrakesch, um den nächsterreichbaren Rückflug zu nehmen. Ich habe beschlossen, die paar Tage bis zur Finisherparty zu bleiben. Müsste sonst alles umorganisieren. Lieber ein paar Tage erholen. Scheißinfektion!
Die meiste Zeit liege ich auf der Liege vor meinem Hotelzimmer und starre apathisch in den Himmel. Ich könnte ans nahe Meer gehen, habe aber keine Lust. Neben mir zwei Österreicher, die ebenfalls abbrechen mussten. Sie zerlegen schweigend ihre Räder, packen sie in die Transporttaschen. Das habe ich bereits hinter mir. Wir smalltalken ein bisschen, die Stimmung bleibt so la la.
Ich schaue immer wieder auf DotWatcher, gehe mehrfach zum Finish, um zu fotografieren und zu filmen: Es gibt keinen offiziellen Fotoservice, wenn du Erinnerungen haben willst, dann musst du sie schon selber machen. Verstrahlte Touristen bitten, dein Finisherfoto zu knipsen. Oder du kennst einen Typen wie mich, der eine Viertelstunde auf dich wartet, bis du einrollst mit deinem staubigen Bike und ein Video aufnimmt von deiner epischen Zielankunft. Der Deutsche Sönke Kreft schafft es als Letzter innerhalb des Zeitlimits in die Wertung auf Platz 119. Alle haben mitgefiebert, ob er es rechtzeitig über die Ziellinie schafft. Als er endlich in der Dämmerung einrollt, 31 Minuten vor dem Cutoff, applaudieren ihm mehrere Dutzend Teilnehmer. Episch.
Bei der Finisherparty hören wir noch ein paar krasse Geschichten: Einer der Teilnehmer hatte einen schweren Mountainbike-Unfall, seine Ärzte haben gesagt, er würde nie wieder Rad fahren. Nicht nur saß er bald wieder auf dem Bike, er hat dieses unfassbar harte Rennen gefinisht. Ich nicht. Eine Frau erfuhr während des Rennens vom Tod ihres Freundes in Südamerika. Sie ist weitergefahren und hat ihm unter Tränen ihr Finish gewidmet.
Das hier ist eine globale Community von Eskapisten, aus den USA, Kanada, aus Südafrika, Südamerika, Namibia, Europa. 42 Nationen, völlig losgelöst vom Weltgeschehen. Es geht um die Beine, um Ausrüstung, um die Landschaft, auch um das Zuhause und das jeweilige „make a living“. Nie geht es um Politik, um Ideologien oder um all die anderen komplizierten Alltagsprobleme. Einige sind über Wochen oder Monate mit dem Rad angereist, wollen und werden weiterreisen, eine vollkommen andere Sicht auf die Welt. Shona Oldfield und Richard Naylar aus Manchester/Großbritannien haben das Rennen als Pair auf einem Tandem gefinisht – nachdem sie im Jahr zuvor einmal gescheitert waren. Unvorstellbar, allein der Gedanke an den Abstieg durch den Schnee!
Ist dies etwa das wahre Leben - oder ist es eine bewusst gewählte Auszeit? Egal, das Atlas Mountain Race ist faszinierend, maximal intensiv, einmalig, für immer. Auf nichts freue ich mich jetzt mehr als auf jene so selbstverständlich genutzten Kostbarkeiten zuhause: Wasser ohne jede Sorge direkt aus dem Hahn zu trinken, so viel du willst. Salate, frisches Obst, eine endlose Dusche, das eigene kuschelige Bett, meine beiden Jungs, die Familie. Du setzt dich Extremen aus, um mehr wertzuschätzen, was es bedeutet, nicht mehr ausgesetzt zu sein.
Mut schreit nicht immer. Manchmal sagt er auch nur ganz leise: Nächstes Jahr versuche ich es nochmal. Vorausgesetzt, ich kriege einen Startplatz - und bleibe gesund.
Wahrscheinlich hört das niemals auf. Hoffentlich!
Epilog
Ein paar Wochen später treffe ich Nelson Trees, den Gründer des Atlas Mountain Race, in Düsseldorf auf der Cycling World. Er plant ein viertes Rennen, das Taurus Mountain Race, in der Türkei. Es soll erstmalig Ende Oktober 2026 ausgetragen werden. Er ist auf Sponsoren-Akquise. Ich sage ihm, dass ich es gerne nochmal beim Atlas Mountain Race versuchen würde, den Rennabbruch dieses Jahr könne ich nicht auf mir sitzen lassen. Er grinst und meint „that’s part of the business model”.
Nächstes Mal dann ohne Aerobars, dafür mit Flat Pedals und absenkbarer Sattelstütze. Vielleicht reicht’s ja sogar für ein Fully. Das Trek Supercaliber ist die Weapon of Choice in den Top Ten dieses Rennens. Aber wer fährt schon einfach so in die Top Ten. Außer Marei Moldenhauer natürlich.

Was ist Unsupported Ultracycling – Noch Radsport oder doch schon eher Survival?
Es ist dieses brachiale Gefühl von Ausgesetztheit, unter extrem anspruchsvollen Bedingungen komplett auf sich selbst gestellt zu sein. Die Faszination des Ultracycling liegt in der Grenzerfahrung: Es geht darum, herauszufinden, wie viel Belastung du bewältigen kannst und dabei deine körperlichen und mentalen Grenzen zu testen. Diese sehr besondere Variante des Radsports lebt vom wilden Freiheitsgefühl und einem unvergleichlich intensiven Gefühl von Lebendigkeit. Das gibt es nur in ursprünglicher Natur, in den Bergen, auf dem Meer, im Urwald, auf Reisen. Kein gewöhnlicher Tourist wird es jemals spüren.
Ich habe mir ausführlich Gedanken rund ums Unsupported Ultracycling gemacht (in Unterscheidungen zu anderen Herausforderungen und Wettbewerben im Radsport).

Überhaupt bis zur Startlinie zu kommen: auch schon eine Leistung
Die Startlinie in Marrakesch ist nicht der Beginn des Rennens. Sondern eher so etwas wie das Basislager auf einer Achttausender-Expedition: Die Unternehmung hat in Wirklichkeit schon Monate vorher begonnen. Es ist bereits eine Leistung, mit dem fertig aufgebauten Bike rechtzeitig und ohne krank geworden zu sein an der Startlinie zu stehen.
Meine Wochen und Monate vor dem Startschuss bieten jedenfalls derart viel zu erzählen - unmöglich, das alles hier auf einer einzigen Seite untereinander festzuhalten. Ich habe die Monate vor dem Rennen deshalb in ein paar thematische Abschnitte unterteilt:
- Startplatzbewerbung
- Ärztliches Attest
- Mit dem Fahrrad ins Flugzeug
- Gabelflug und die Angst vor Gepäckverlust
- Air Tags sind besser als nichts - aber auch nicht das Gelbe vom Ei
- Influenzaviren und andere Infektionskrankheiten der Wintersaison
- Es geht los: Rennvorbereitung und Wintertraining
- Wie trainiert man für ein Ultracycling-Event?
- Winter ist die mieseste Zeit für den Formaufbau
- Zu wenige Testkilometer auf dem Racebike - das würde sich bitter rächen
Das Rad und sein Aufbau wird zudem ebenfalls ein eigenes Stück bekommen.
Über die Technik gibt's nämlich nochmals so viel zu erzählen. Ergänzen will ich auch noch was zur Routenplanung und zur Navigation.

Navigation und Routenplanung für das Atlas Mountain Race
Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob du im engmaschig erschlossenen Deutschland am Wochenende einen kleinen Overnighter fährst. Oder ob du in Marokko tagelang in unbekanntem Gelände bei Extrembedingungen unterwegs bist. Auf einigen Abschnitten wird es Dutzende von Kilometern einfach nichts um Dich herum geben als Wind, Sand und Steine. Kein Wasser, keinen Shop, keinen Fahrradladen, kein Mobilfunknetz, nichts. Du musst also sorgfältig planen. Die richtigen Tools und Geräte dabei haben. Einen Plan B haben. Darüber habe ich mir hier Gedanken gemacht:

Ausrüstung - Best Practices und persönliche Erfahrungen
Ausrüstung ist ein weiteres endloses Thema für sich. Darüber ließen sich ganze Bücher füllen (ach komm Bücher, wer liest denn noch Bücher über Ausrüstung! Einen eigenen Youtube-Channel sollte ich starten, jo), und ständig kommen neue gute Ideen dazu. Andererseits versucht die Industrie unentwegt, dir den neuesten heißen Scheiß anzudrehen - der aber häufig genug keine echten Verbesserungen bringt, sondern manchmal jede Menge Ärgernisse oder sogar Rückschritte. Für jede Menge Kohle. Zu viele Dinge werden hergestellt, nur um verkauft zu werden, nicht um benutzt zu werden. Gerade im Outdoor-Business.
Dagegen hilft nur Praxis. Testen, testen, testen, unter allen denkbaren Bedingungen. Je mehr du unterwegs bist, desto weniger Gegenstände wirst du brauchen mit der Zeit - aber was du dabei hast, ist hochwertig, langlebig und möglichst einfach. Je mehr Erfahrung, desto mehr Aufgaben erfüllt jedes einzelne Stück, das du in deine Taschen packst. Ich habe mal versucht, das zu strukturieren:
Es ist noch nicht fertig. Wird es vermutlich nie sein. Wie gesagt: Youtube-Channel.

Das Bike mit seinen Umbauten, Taschen und der Packliste verdient eine eigene Geschichte. Das Cube XC Race Hardtail hat jetzt den dritten größeren Umbau hinter sich (für Badlands hatte ich es auf Dropbar umgerüstet). Es hat nun, Anfang 2026, einen Stand, in dem sich meine gesammelte Ultracycling-Erfahrung widerspiegelt. Vielleicht mache ich daraus aber auch einfach mal ein Video.