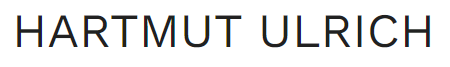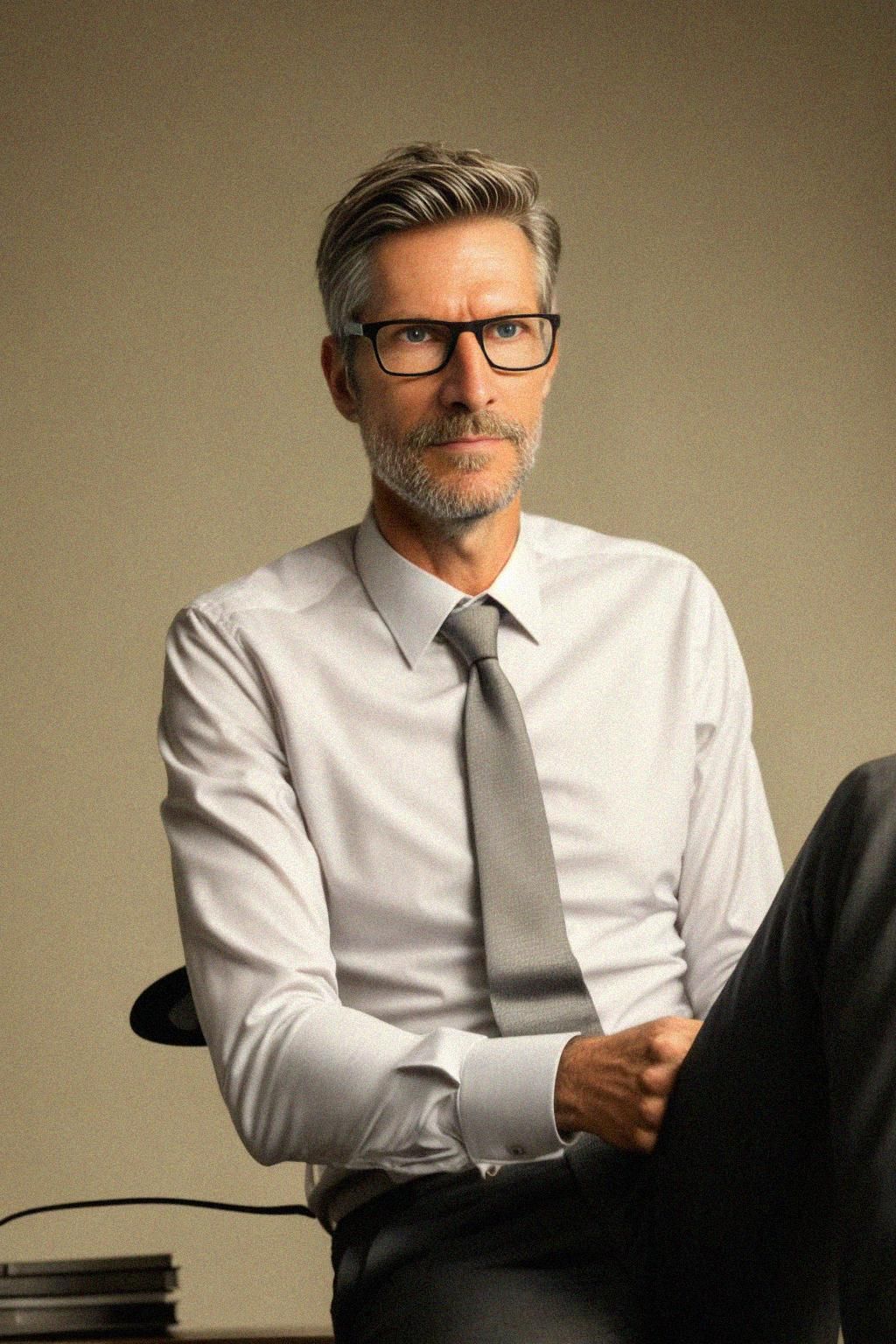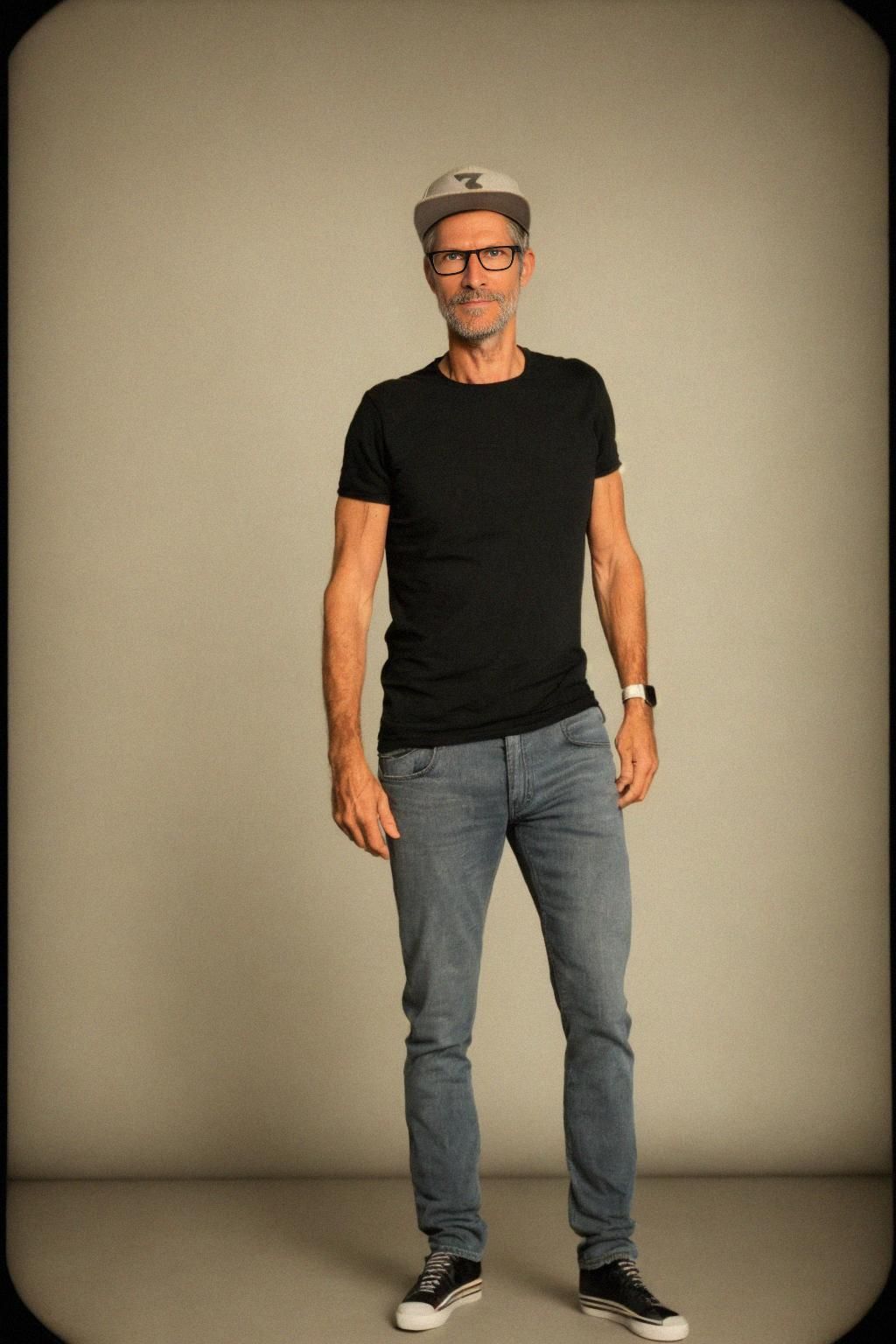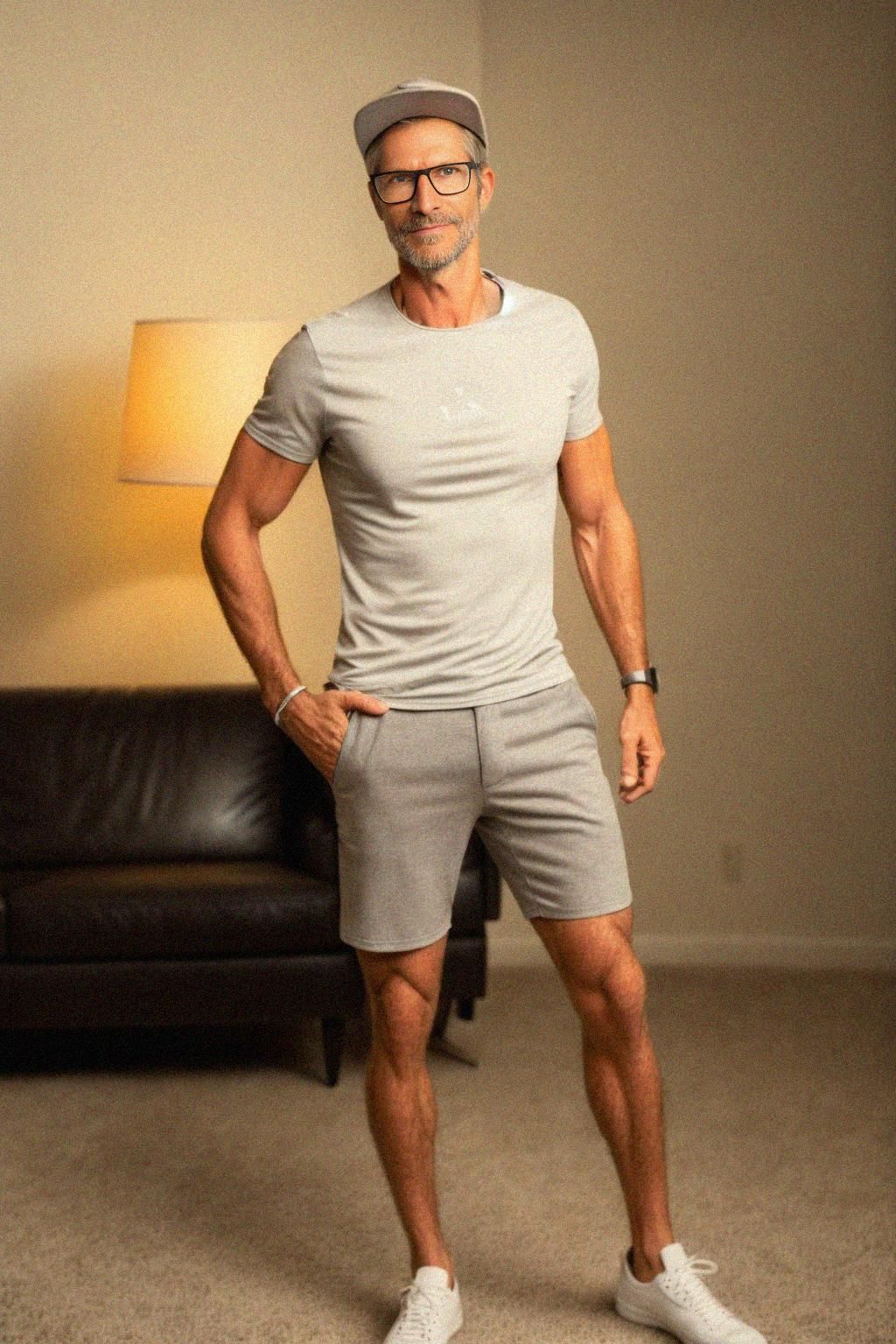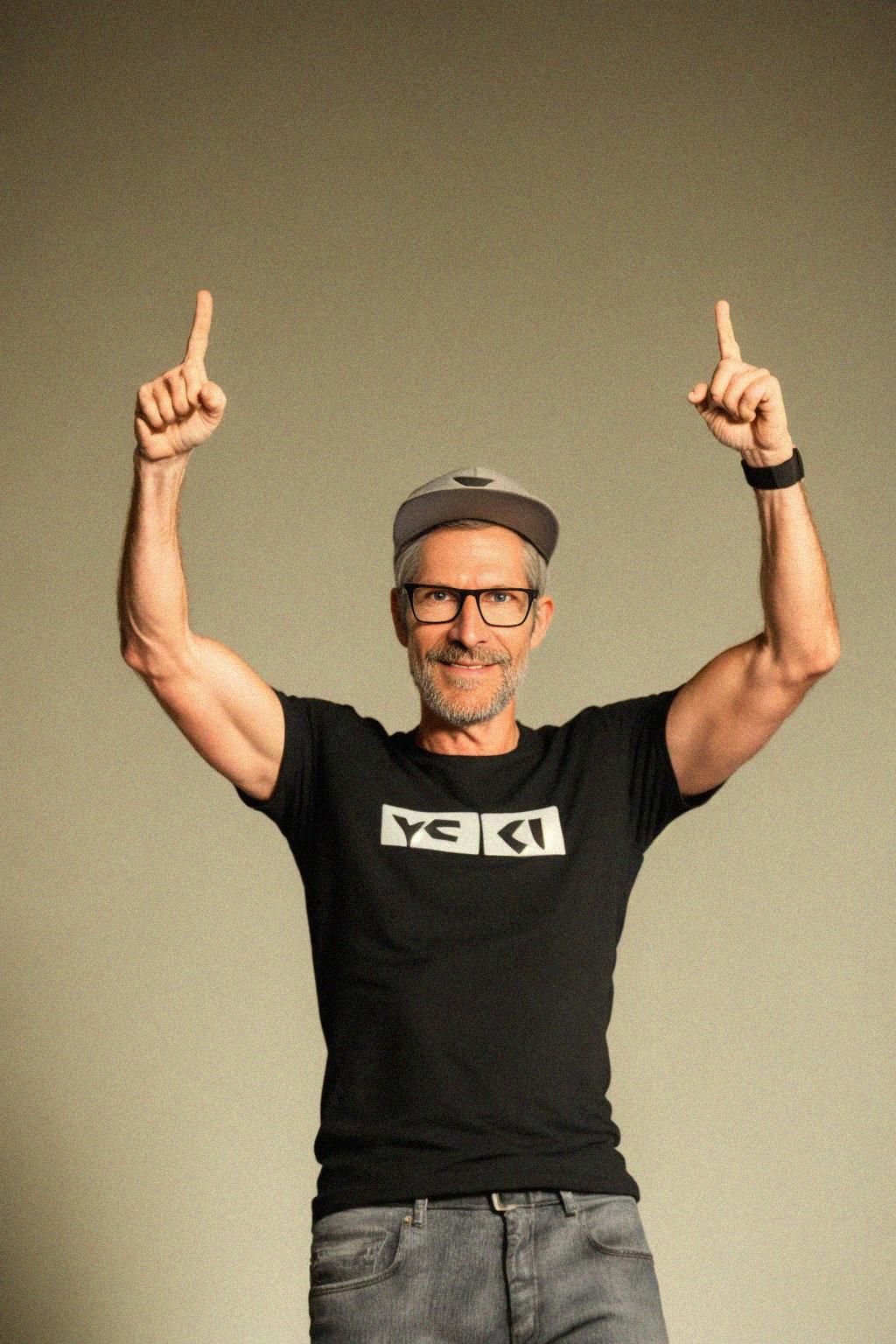Diese Bilder sind keine Fotos. Sie sind KI-generiert. Die Porträts entstanden Anfang 2024, aus Neugierde und Experimentierfreude. Die Bierbauch-Variante ist ebenso Fake wie der Heroin-Chic mit Tattoos. Was passiert mit Wahrnehmung und Vertrauen, wenn Wirklichkeit so einfach zu fälschen ist?
Schwer zu übersehen: Ich liebe Abenteuer. Bekanntlich besteht das Wesen des Abenteuers darin, dass sein Ausgang ungewiss ist. Es kann schief gehen. "Courage is knowing it might hurt and doing it anyway. Stupidity is the same. That's why life is hard." Abenteuer stehen synonym für Freiheit und "intensives Leben". "Es geht nicht darum, wie viele Jahre du gelebt hast", sagt der Weltklasse-Kletterer und Alpin-Star Alexander Huber, "sondern darum, wie du diese Jahre mit Leben gefüllt hast". Die Gipfel, die du erreichst, bestehen nicht nur aus Fels und Eis, sondern auch immer aus deinen Sehnsüchten und Träumen. Du wirst dich an dein Leben erinnern durch die Momente, die dir den Atem genommen haben. Entstanden die besten Geschichten nicht immer genau dann, wenn es nicht so lief wie du es dir vorgenommen hattest?
Auch wenn du alt wirst, kannst du immer noch krassen Scheiß machen. Nur langsamer. Tragisch wäre es allerdings, sein Altern nicht akzeptieren zu können und in Rollen festzuhängen, die nicht mehr passen. Längst kann ich meine eigenen Limits nicht mehr erweitern. Die Spielräume werden kleiner. Der Kampf gegen die Uhr hingegen bleibt. Nur ist er jetzt ein ganz anderer geworden: Es geht nicht mehr um Sekunden. Sondern darum, möglichst viele gute Jahre zu bekommen. Du kannst einiges dafür tun. Eine Garantie gibt es aber nicht. Das Leben bleibt ein Geschenk, bis zum Schluss.
Der Mythologe und Publizist Joseph Campbell (der auch den literarischen Begriff der "Heldenreise" geprägt hat) sagte einmal, Menschen suchten gar nicht nach dem Sinn des Lebens. Sondern nach Lebendigkeit. Von Glück sprach er interessanterweise nicht. Rührt das Unglück der Menschen nicht vor allem daher, dass sie ständig fragen, was Glück ist? Menschen suchen den Weg zum Glück - und begnügen sich mit Spaß, Lust und Schmerzvermeidung.
(Rad)sport hilft, besser mit den Härten des Lebens umzugehen
Überhaupt Schmerzen: Die Angst vor Schmerzen ist in Angstgesellschaften wie der deutschen gerart groß, dass man das Thema nicht nur nicht diskutieren kann. Sie führt auch zu einem ziemlich verzerrten Blick darauf, was ein gutes Leben ist: Im Grunde ist allen klar, dass das Leben nicht nur aus guten Tagen besteht. Dass die schmerzvollen, mühsamen Tage bei weitem überwiegen. Trotzdem propagiert die Gesellschaft pausenlos (ihre Werbung!) weiter Glück durch Bequemlichkeit. Als ob es je einen Job geben könnte, der ohne schwierige Tage auskäme. Erzählt euren Kindern nicht, dass sie nach einer Arbeit suchen sollen, in der sie immer glücklich sind. Denn die werden sie nicht finden. Sie werden ein Studium beginnen, es abbrechen und ein zweites nicht beenden. Sie werden von Arbeitgeber zu Arbeitgeber wechseln und auch in der Selbstständigkeit nicht zufrieden sein. Erzählt ihnen, dass sie sich für etwas entscheiden sollen, bei dem die Sinnhaftigkeit und der Stolz auf das Getane die mühsamen, schmerzhaften Abschnitte überwiegt. Und vermittelt ihnen die Fähigkeit, anders mit den Schmerzen des Lebens umzugehen als die meisten Menschen.
Great things never came from comfort zones
Bin ich deswegen dafür, den eigenen Kindern (oder anderen Menschen) "heilsame" Schmerzen zuzufügen? Gott bewahre, nein! Den Umgang mit den eigenen körperlichen oder seelischen Schmerzen muss jeder Mensch selbst mit sich ausmachen - schon weil Menschen so verschieden sind. Mir zum Beispiel hat der Radsport viel geholfen: Nicht nur hat er mich gelehrt, auch dann noch weitermachen zu können, wenn der Körper längst schreit "es geht nicht mehr, gib auf!". Er hat mich auch einen anderen Umgang mit Schmerzen gelehrt. Interessanterweise scheint körperliche Widerstandsfähigkeit auch psychisch zu wirken. Diese Erfahrung kann ich zwar mitteilen. Machen muss sie jeder für sich.
Fest steht: Great things never came from comfort zones. "Ihr findet kein Glück da draußen", sagt der Zen-Lehrer Hinnerk Polenski, "das Glück ist in Euch selber". Und noch einer: "Ob wir unser Leben als gelungen empfinden, hängt davon ab, wie sehr wir uns mit der Welt verbunden fühlen", sagt der Soziologe Hartmut Rosa in seinem Buch "Resonanz". Ein Schreibtisch eignet sich allerdings nur sehr eingeschränkt dafür. Ein Bildschirm erst recht nicht.
Leicht zu übersehen:
Abenteuer beschränken sich keineswegs auf Outdoor. Wirtschaft ist auch ein Abenteuer. Und was für eins! Und
was die Menschheit gerade mit KI erlebt, ist vielleicht ihr größtes Abenteuer überhaupt.
Wir ziehen uns gerade den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen weg
Meine Profilbilder da oben sehen genau aus wie ich. Aber das bin nicht ich. Auch aus einer optischen Kamera wären es nur Abbilder (mit deren Trughaftigkeit hat sich bereits 1929 der junge Rene Magritte auseinandergesetzt, einer der Pioniere des Surrealismus:
Ceci n'est pas une pipe). Es handelt sich um maschinengenerierte Avatare oder Deep Fakes. Für das Training
der eingesetzten KI
reichten eine Handvoll Fotos aus einem einzigen Shooting. Auch wenn genaueres Hinsehen noch etliche Fehler zeigt, wer die Bilder mit dem lebenden Original vergleicht, wird denken: holy crap! Finde ich das noch faszinierend oder schon furchterregend?
Zieht uns der Surrealismus des 21st Century gerade den Boden unter den Füßen weg? Beginnen die Werkzeuge, die wir geschaffen haben, uns nun selbst zu benutzen? ("First we shape our tools, and thereafter our tools shape us").
Das Internet wie wir es kennen, zerstört sich gerade selbst. Brillante Gedanken dazu z.B.
aus dem Internet-Observatorium
von Johannes Kuhn, vom Neurologen und Schriftsteller Erik Hoel
oder vom Web-Pionier und Digitalvordenker
Cory Doctorow.
Eine eigene Webseite, so ganz ohne Verkaufs- und Reichweitenziele? Nun, im Zeitalter der KI-Suchmaschinen kannst du den Crawlern immerhin "mitteilen", was sie über dich "wissen" - die eigene Webseite wird zum zentralen Instrument des Personal Branding für das KI-Zeitalter - obwohl sie keinerlei Reichweite mehr hat (👉
LLMO/GAIO). Das ist aber nicht der Hauptgrund für mich:
Aufschreiben klärt Gedanken, sortiert, hilft erinnern, bereichert. Wir definieren uns über die Erinnerungen, die wir von uns selbst akzeptieren.
Früher oder später erfindet sich jeder eine Geschichte, die er für sein Leben hält.
Fahrräder und Outdoor-Sportarten sind meine Leidenschaft und mein Why,
Kommunikation mein Metier. Ich biete reiche Marketing- und Kommunikationserfahrung, liebe digitale und technische Themen und habe Veränderung nie als Bedrohung empfunden, sondern meist als Gestaltungschance. Was ist ein gutes Leben? Was ist gute Arbeit? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Kann Wirtschaft florieren,
ohne
den Planeten zu zerstören?
Mehr über meine berufliche Vita findest du auf meinem LinkedIn-Profil.
Wenn du mehr über mich wissen möchtest: Lass uns irgendwo auf einen Kaffee treffen. Ein gutes Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Durch AI jedenfalls nicht.
.
Freiheit hat immer einen Preis. Du bezahlst mit Angst.
(Wer schon frei ist, muss nicht mutig sein)
"Bitte, was ist ein gutes Leben?"
"Oberflächlich betrachtet gibt es nichts Wichtigeres, als immer die kürzeste Verbindung zu gehen. Alle wollen das von dir: Geh direkt, trödel nicht, sei effizient. Sei schnell. Schneller. Ich kannte lange nichts anderes. Mancher bewegt sich sein Leben lang so. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Er ist viel unklarer, unsicherer und mühsamer als der sichtbare Weg. Aber er öffnet neue Perspektiven. Er führt unter die Oberfläche. Er öffnet die Augen."
"Dann ist der längere Weg also der bessere?"
"Das weiß ich nicht. Auf diesem Weg kann nicht jeder glücklich werden. Er ist oft kaum zu ertragen. Möglicherweise ist der Umweg am Ende aber sogar der schnellste. Du kannst dein Werden nicht abkürzen."
"Wie heißt denn der Weg?"
"Freiheit."
(aus meinem alten Weblog, 2004)
Wie man leben soll
👇